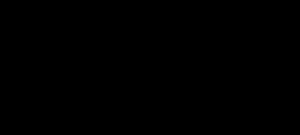Texte
Übernehmt Verantwortung, Pädagogische Hochschulen und Volksschule!
In der NZZ vom 19. Dezember 2024 ist mein Gastkommentar zum Thema Leseschwäche der Schweizer Bevölkerung erschienen.
pdf: Die Lesemisere ist hausgemacht / Meinung & Debatte
Auszug aus «Wenn du nicht wärst.»
Hunde und Halter, Kinder und Kinder, Jogger und Joggerinnen rennen in mein Sichtfeld und wieder hinaus. Alles ist möglich, frohlockt der Märzwald und ich frage mich, ob ich eine dramatische oder heitere Liebesgeschichte erzählen soll. «Sie muss zum Titel Szenen einer Liebe passen und darf nicht nach mehr als einer Schauspielerin und einem Schauspieler verlangen», ist mir die Regisseurin in den Ohren. «Wenn nötig, kannst du auch meine Tochter für eine kleine Rolle einplanen.»
Der Wald kläfft. Wenn ich an Liebe denke, denke ich daran, was mir fehlt. Umschlungen einzuschlafen, eine Beobachtung zu teilen, beim Zähneputzen etwas erzählt zu bekommen.
Der Gedanke treibt mich in die Küche. Ich warte auf das Lichtzeichen der Kaffeemaschine, stelle eine Tasse unter den Brühhahn. Das Wort Liebe kommt mir wässrig vor. Täglich wird alles Mögliche hineingeschüttet. Ein lächelndes Paar mit Eigenheim, Hochzeitskleider, Sonnenuntergänge. Das dichte Braun des Kaffees duftet nach Konzentration.
Am Waldrandfenster bellt es noch immer und die Frage «Tragödie oder Romanze?» hängt über meinem Pult. Können Kläffer nicht schweigend spurten?
Falsche Frage. Eine Liebesgeschichte vom Ende her zu denken, wäre Verrat an der Liebe. Lieber beginne ich mit dem Anfang; da streckt sich alles aus, wächst sich entgegen. Danach folgen Momente. Liebevolle, unaufmerksame, verunsichernde, wache, belustigende, verletzende. Das Ende hängt von der Geduld der Liebenden ab oder von der Länge des Theaterstücks.
Im Wald tappen Kleinkinder in signalgelben Westen einer Frau hinterher. Ein Kind stolpert, fällt auf die Knie.
Kann man aus einem Drama eine Romanze machen, indem man die Geschichte nicht am hoffnungslosesten Punkt beendet?
Das altgediente Buch auf meinem Pult gibt keine Auskunft, doch seine Seiten lassen mich mitten in einer Geschichte von Königen und Königinnen landen, deren Liebe zu Inzest, Verrat und Tod führt. Die Zeile «Geh jetzt, lass die Kinder los!» lässt mich auf die Uhr schauen. Es ist Zeit für die Schülervorträge über Mythen.
Englischer Auszug aus «Nochmal tanzen»
«Dance again»; Übersetzung von Donal McLaughlin als pdf:
English Extract
Essay aus dem Band «Interventionen1»: Einfach so
Manche Kunstwerke wecken in mir den Wunsch, malen zu können. Abstrakt malen oder zeichnen, mit dickem Stift oder breitem Pinsel, auf grossen Flächen, mit weiten Bewegungen. Ich stelle es mir schön vor, ausserhalb der Sprache zu wirken.
Da wären zum Beispiel Linien. Nichts als Linien. Eine Linie ist auch als Strich Linie, solange der Strich nicht abschattet, strähnt, eine Kutte färbt oder einen Bauern umreisst. Eine Linie kann verbinden, sich verknoten, kreuzen, markieren, liegen, stehen, sie kann weich sein, geschwungen, entschieden, zart, gerade, dick, dynamisch, starr. Aber sie muss nicht. Sie kann ein Strich sein, nichts als das.
Ein Wort steht nie für sich. Es deutet zum Beispiel auf Brot, Mann, blendet, Messer, draussen und schon sitzt draussen ein Mann, der geblendet wird und mit dem Messer Brot schneidet. Die Wörter greifen nach Bedeutung, Bezug, Gestalt. Sehe ich eine Linie, wirkt sie. Beschreibe ich wie sie wirkt, hört sie auf, Linie zu sein. Sie verliert sich in Verben, Substantiven und Adjektiven. In der Sprache gibt es zwischen zwei Punkten keine Gerade.
Ich sehne mich nach einem Ausdrucksmittel, das eine Linie Linie sein lassen kann und sie nicht belädt mit Geschichte und Geschichten. Auf der Linie lasten die Richtschnur, die Hierarchie, die Wäscheleine, die Gefechtsform, der richtige Ton, die Abgrenzung, der Horizont, das Mass. 17 Paragraphen werden im Grimmschen Wörterbuch zur Linie aufgelistet.
Ich kann weder malen noch zeichnen. Als Kind tat ich es trotzdem. In der Primarschulzeit hörte ich Geschichten vom Kassettenrecorder und malte die Quadrate auf kariertem Papier mit Filzstift aus. Die Form war gegeben, das Konzept minimal: Die Farbquadrate durften sich nur an den Ecken berühren. Als ungelenke Zeichnerin wollte ich zeichnen, ohne etwas darzustellen. Ich malte einfach so. Einfach so, wie ich auf dem Schulweg zu hüpfen begann oder sang. Dank dem minimalen Konzept fragte kein Erwachsener, was auf meiner Zeichnung zu sehen sei. Da war nur das Einfachso, das ich noch heute suche, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, um zu schreiben.
Um einfach so zu schreiben, helfen mir weder Raster noch Konzept. Zeit, Alleinsein und der Baum vor dem Fenster hingegen schon. Ich schaue ins Grün, sehe Meisen picken, Äste wippen. Ich höre die Stille. Sobald sich die Stille bis ins Denken ausgebreitet hat, suchen die Finger nach Rhythmus. Rhythmus, der die Wörter zum Klingen bringt, zum Schwingen. Schwingen die Wörter, schaffen sie Raum um sich, in dem sich Wesen einnisten, Bezüge. Einfachso gibt es in Texten nicht. Da sind Bilder, Bedeutung, Klang und Handlung. Einfach so kann ich nur am Schreibtisch sitzen, die Stille aufnehmen und versuchen, mich konzentriert auf nichts zu konzentrieren.
Ich sehne mich nach Konzentration, die sich selbst genügt. Einen Zirkel zur Hand nehmen, die Spitze in die Wand stecken, die Mine kreisen lassen. Einstechen, kreisen. Wieder und wieder, ohne etwas zu beherrschen. Linien entstehen lassen, nichts als Linien.
Mehr als Linien. Die Wand verzittert den Strich, die Länge der Linien entzieht sich dem Überblick, ihre Unzahl verbirgt das Raster. Die Linien werden zum Netz. Auf der Suche nach Ordnung folgen die Augen den Linien von den Ecken her, von unten, von der Seite, das Oben ist zu weit weg. Das Tageslicht, das von der Seite auf die Wand fällt, löst das Netz stellenweise auf. Die Augen verlieren den Faden und sind erfüllt. Erfüllt von Ruhe, Konzentration und Nichts.
«Konzeptionelle Künstler sind eher Mystiker als Rationalisten», schrieb Sol leWitt 1969 in seinen Sentences on Conceptual Art fünf Jahre vor der Vollendung seiner Wandzeichnung Kreise, Raster und Bögen von vier Ecken und vier Seiten im Basler Museum für Gegenwartskunst. Zog Sol leWitt seine Linien so, wie es meine Sehnsucht ausmalt? Versunken, still, lose konzentriert wie ich damals beim Ausmalen von Quadraten? Hörte er Radio dazu? Vergass er die Zeit?
Es heisst, Sol leWitt habe Subjektivität vermeiden wollen. Tat er das? Vielleicht interessierte ihn individueller Ausdruck bei seiner Arbeit ebenso wenig wie das Darstellen eines Bauern beim Brotschneiden. Aber ist ein Konzept, eine Idee nicht ebenso Ausdruck einer persönlichen Sicht auf die Dinge, auf die Kunst, wie ein Gemälde? Ist das Ziehen von Linien, das Zeichnen von Kreisen nicht ebenso Ergebnis einer Handschrift wie die Farbschicht auf einer Leinwand? Kann ein bildender Künstler objektiv sein?
Als Schriftstellerin kann ich Subjektivität weder verhindern, noch muss ich mich darum bemühen. Sprache ist immer subjektiv – ausser sie erstickt in Formalitäten. Meiner Sprache liegt die sinnliche und sinnende Wahrnehmung zu Grunde.
Im Zentrum von Sol leWitts Kunst standen Ideen und Konzepte. Ihre Realisierung fand er nicht nötig, Kunstfertigkeit strebte er nicht an – und erlangte sie trotzdem. Widmet man sich wie er hingebungsvoll einer Sache, stellt sich mit den Jahren zwangsläufig Meisterschaft ein. Man wird Expertin im Beobachten, Experte für Materialien, Formate, Werkzeuge, Formen. Man umkreist von Tag zu Tag seine Themen, lotet die Grenzen des Machbaren aus und schafft es doch kaum darüber hinaus. Deshalb träume ich vom Malen. Ob Sol leWitt vom Schreiben träumte?
Im Gegensatz zu Sol leWitt sind für mich Ideen nicht Ausgangspunkt meiner Arbeit. Sie entstehen beim Schreiben über Beobachtungen, Stimmungen, Beziehungen und Gefühle und beim Ausprobieren von Formen. Realisiere ich die Ideen, sind sie Teil meiner Texte. Schreibe ich sie nicht nieder, versickern sie.
Bedingung zum Schreiben ist das Einfachso. In sinnloser Konzentration suche ich nach Wörtern, zwischen denen Räume entstehen, die grösser sind als meine Ideen es sein können, und offener, als was ich mir ausdenke.
Betrachte ich Kunst, die mich etwas angeht, ist die Konzentration da. Sie bewirkt, dass sich Räume öffnen. Die des Künstlers und meine. Die Wand mit den Linien von Sol leWitt geht mich etwas an. Etwas, das ausserhalb der Sprache liegt.
Sol leWitt: Circles, Grids and Arcs from Four Corners and Four Sides (ACG 195), 1973–1974, Wandzeichnung, 720 x 432 cm, Kunstmuseum Basel, Geschenk des Künstlers im Andenken an Dr. Carlo Huber 1977
Auszug aus «Eine Andere»:
Jetzt muss sie. Eine Freundin schreibt ihr, «nur rasch, habe viel zu tun». Die Freundin macht sich Sorgen um sie: «Taucht im Lebenslauf auch nur die kleinste Irritation auf, bist du weg.» Sie weiß das. Sie hat die Lücken gefüllt, Umwege so kurz wie möglich gehalten.
Sie gibt ihr Bestes. Jedes Mal. Kürzlich wurde sie nach einem zweistündigen Bewerbungsgespräch schriftlich getestet. Sie musste ein Marketingkonzept schreiben. Die Befrager waren mit dem Resultat zufrieden. Und sagten ihr ab mit der Begründung, sie sei zu gut gewesen, zu souverän. Der Inhaber einer Werbeagentur studierte vor ihren Augen den Lebenslauf und verwickelte sie danach in ein Gespräch über ihre Einstellung zu Konsum und ihre Vorliebe für Lyrik. Zum Schluss sagte er, sie sei ein Nischenprodukt. Sie war ihm dankbar. Die meisten sagen nicht, was sie denken. Sie gehen einen Fragebogen durch. Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Mit einem Nicken quittieren sie den Satz, sie sei an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Er scheint ihnen, zusammen mit dunkler Hose und heller Bluse, Diplomen und Zeugnissen, die Sicherheit zu geben, die sie suchen.